Zuletzt aktualisiert am 28. Januar 2025 von tirolturtle
Endoprothesenregister: Was ist das und wie hilft es den Patienten? Führen Daten über Knie- und Hüftendoprothesen zu mehr Patientensicherheit?
Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) wurde 2010 gegründet, um
- Daten über die Versorgung mit Knie- und Hüftendoprothesen zu sammeln und auszuwerten,
- um die Qualität verwendeter Endoprothesen zu sichern und zu verbessern
- und dadurch die Patientensicherheit zu erhöhen.
Seit Ende 2012 können Kliniken die Daten der implantierten Prothesen und damit versorgten Patienten in das Endoprothesenregister Deutschland eintragen. Damit lassen sich frühzeitig wertvolle Rückschlüsse, etwa auf Implantatversagen, ziehen und so größere Schäden in der Breite vermeiden.
Der umfangreiche Datenpool des EPRD erlaubt es, die Ursachen für einen eventuellen Misserfolg bei einem Endoprothesen-Eingriff leichter als bisher aufzuschlüsseln. So lässt sich im Falle eines Falles klären, ob die verwendeten Implantate, das operative Vorgehen oder patientenspezifische Merkmale für eine erneute Operation verantwortlich sind.
Kliniken, die viele künstliche Hüft- und Kniegelenke implantieren, weisen tendenziell bessere Operationsergebnisse auf als Einrichtungen, die wenige Eingriffe durchführen.
Als Patienten-Wegweiser gilt dazu das EndoCert Prüfsiegel. Kliniken, die das EndoCert Prüfsiegel tragen, müssen sich einer jährlich wiederkehrenden Überprüfung stellen und verpflichtend am EPRD mitarbeiten. Über EndoCert lassen sich auch österreichische Kliniken bzw. EndoProthetikZentren (EPZ) und EndoProthetikZentren der Maximalversorgung (EPZmax) abrufen!
Weiteren Einfluss auf die erfolgreiche Verweildauer einer Prothese im Körper, die sogenannte Standzeit, haben die verwendeten Prothesenkomponenten und -materialien sowie die Patienten selbst.
Der Einsatz von jährlich mehr als 400.000 künstlichen Hüft- und Kniegelenken gehört zwar zu den häufigsten Operationen, die in Deutschland durchgeführt werden. In Österreich sind es etwas rund 40.000. Gleichzeitig sind aber in Deutschland jährlich mehr als 30.000 Wechseloperationen erforderlich.
Zusammengefasst hängt das Outcome einer endoprothetischen Versorgung maßgeblich von drei Faktoren ab:
- dem Leistungserbringer
- der Patienten-Compliance
- und dem Implantat
Das Endoprothesenregister Deutschland in Kürze:
- Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) ist ein freiwilliges Register.
- Ziel ist die Qualitätsmessung und Qualitätsdarstellung der endoprothetischen Versorgung in Deutschland.
- Das EPRD wurde 2010 auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) gemeinsam mit dem AOK-Bundesverband GbR, dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) sowie dem Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed) aufgebaut.
- Betreiber des EPRD ist die gemeinnützige EPRD Deutsche Endoprothesenregister gGmbH, eine hundertprozentige Tochter der DGOOC.
- Mit mehr als 3 Millionen erfassten OP-Dokumentationen und 760 datenliefernden Kliniken ist das EPRD das zweitgrößte endoprothetische Register in Europa und das drittgrößte weltweit.
- Das EPRD hat gemeinsam mit der Industrie eine Produktdatenbank aufgebaut, die detaillierte Informationen über Produkteigenschaften (Geometrie, Oberflächenbeschaffenheit, Material) und Funktionalitäten von mittlerweile mehr als 70.000 Implantatkomponenten enthält.
- Das EPRD ist ein freiwilliges Angebot – auch an die Patienten. Sie werden im Rahmen des Aufklärungsgesprächs vor Operationen auch über den Ablauf der Datenerfassung sowie Zweck und Ziel des EPRD informiert. Nur wenn die Patienten einverstanden sind und eine Einwilligungserklärung unterzeichnen, werden die Daten zum Implantat und zum Eingriff erfasst und pseudonymisiert* an die Registerstelle übermittelt.
- Für Patienten ist die Teilnahme am EPRD kostenfrei.
Quelle: Pressemitteilungen Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie
Endoprothesenregister Deutschland: erfolgreiche Bilanz
Zum zehnjährigen Jubiläum zog das Endoprothesenregister Deutschland das 10-jährige Jubiläum eine dementsprechende erfolgreiche Bilanz:
Prof. Carsten Perka, ärztlicher Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und wissenschaftlicher Leiter sowie Sprecher des Executive Committee des EPRD:
Die verbesserte Nutzung von Gesundheitsdaten für die optimale Versorgung unserer Patienten sowie auch für die klinikübergreifende Forschungsarbeit ist ein Riesenthema. Das EPRD hat an dieser Stelle wertvolle Pionierarbeit geleistet.
Dipl.-Kfm. Marc D. Michel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Medizintechnologie e.V. (BVMed) und Sprecher der Geschäftsführung der Peter Brehm GmbH (Spezialanbieter für Endoprothetik)
Das EPRD ist eine gemeinsame Erfolgsgeschichte von Ärzten, Krankenkassen und Herstellern. Wir haben dadurch eine hervorragende Datenbasis, um die Qualität des Versorgungsprozesses und der Implantate beurteilen zu können.
Die nächsten 10 Jahre sind entscheidend für den dauerhaften Erfolg des Registers. Denn es geht um Langzeitdaten. Und es geht um den MedTech-Standort Deutschland.
Den Herstellern müssen die umfassenden Registerergebnisse zur Verfügung gestellt werden, um die unter den Bedingungen der neuen EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) vorhandene Pflicht nach klinischen Daten umfassend erfüllen zu können.
Aber auch das Auffinden von Innovationspotentialen aus Registerdaten steht für die BVMed-Unternehmen besonders im Fokus. Deshalb muss die Erfolgsgeschichte des EPRD fortgeschrieben werden.
Endoprothesenregister Deutschland: Erklärfilm
Was ist ein Endoprothesenregister? Und was macht es? Diese Fragen beantwortet der EPRD-Erklärfilm.
Der animierte Erklärfilm erklärt anschaulich und leicht verständlich die Arbeit des EPRD – ergänzend zur jährlich aktualisierten Patienteninformation:
Wer ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk erhält, hat viele Fragen. Wie läuft die Operation ab? Welchen Einfluss hat das Körpergewicht darauf, dass ein endoprothetischer Eingriff notwendig wird? Wie lange halten Hüft- und Knieimplantate im menschlichen Körper und was sind die Gründe für erneute Operationen am selben Gelenk?
Timo Stehn, Geschäftsführer EPRD, über den neuen Erklärfilm:
Ein weiteres patientenorientiertes Angebot als Bewegtbild neben der Patienteninformation als Printprodukt ist einfach zeitgemäß, insbesondere für diejenigen, die sich über das EPRD bei ihrem Arzt auf unserer Website oder auf YouTube in Form eines Videos informieren wollen.
Wir haben diesen Film auch für unsere datenliefernden Kliniken und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gemacht. Das EPRD lebt von der Zustimmung der Patienten, die sich einverstanden erklären müssen, dass die Daten zum Eingriff und zum Implantat an das EPRD weitergeleitet werden.
Ziel ist es, das Aufklärungsgespräch beim behandelnden Arzt zu erleichtern. Wir sind jetzt schon gespannt auf die Anzahl der Views.
Endoprothesenregister Deutschland: Zehn-Jahres-Vergleich von Implantaten
Jährlich veröffentlicht das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) einen Jahresbericht.
Hier einige Zahlen: Wurden im Jahr 2022 insgesamt 177.826 Hüfterstimplantationen und 137.030 Erstimplantationen am Kniegelenk dokumentiert, waren es 2023 187.640 Hüfterstimplantationen und 155.859 Erstimplantationen am Kniegelenk.
Mit knapp 380.000 übermittelten Dokumentationen im Jahr 2023 sind so viele Datensätze eingegangen wie noch nie seit der Inbetriebnahme des EPRD im Jahr 2012.
Erstmalig hat das EPRD Ergebnisse im 10-Jahres-Zeitverlauf veröffentlicht. Sie geben neue Aufschlüsse über Entwicklungen beispielsweise bei Folgeeingriffen am Hüftgelenk: War 2012/2013 ein lockeres Implantat noch für jede zweite Wechseloperation verantwortlich, so hat sich dieser Wert 2022 auf rund 23 Prozent verringert.
Ähnlich wie bei den Folgeeingriffen am Hüftgelenk zeichnet sich auch bei jenen am Knie im Zeitverlauf ein Rückgang der Lockerungen ab. Im Vergleich zu den Hüft-Folgeeingriffen fällt dieser mit „nur“ elf Prozentpunkten von fast 34 Prozent 2014 auf fast 23 Prozent 2022 geringer aus.
Um ein sogenanntes Mismatch handelt es sich, wenn die Kombination der implantierten Komponenten nicht passend ist. Im Jahr 2022 wurden beispielsweise 27 Fälle bei Hüftgelenkimplantationen registriert, bei denen der Hüftkopf für das Insert oder die Pfanne zu groß war und in 28 Fällen zu klein.
Die Kombination nicht passender Komponenten kann bei zu großen Köpfen zu Hüftverrenkungen führen, bei zu kleinen Köpfen zur folgenschweren Schädigung des Pfanneneinsatzes oder des Kopfes. Einen nachhaltigen Rückgang der jährlichen Mismatch-Fälle konnte das EPRD bisher nicht feststellen.
Die Zahl der Mismatches ist im Vergleich zu 2021 sogar deutlich gestiegen. Um dieser Tendenz zu begegnen und um die Kliniken bei der Vermeidung von Mismatches oder bei deren sofortiger Korrektur zu unterstützen, hat das EPRD eine Software entwickelt, die unmittelbar nach dem Erfassen der Implantate einen Warnhinweis gibt.
Des Weiteren baut das EPRD seine Prüfregeln weiter aus, um noch stärker zur Patientensicherheit beizutragen.
Endoprothesenregister Deutschland: Was passiert mit Problem-Implantaten?
Interessant auch die Frage, wer das Endoprothesenregister finanziert und wenn es zu Problemen mit Implantaten kommt. Dazu ist im September 2023 in der Fachzeitschrift medizin & technik ein Interview mit Prof. Carsten Perka erschienen:
Die Hersteller finanzieren das Register mit und wenden sich mit Fragen an uns.
Wenn die Auswertungen etwa zeigen, dass es mit einem bestimmen Implantat in einer Klinik Probleme gibt, kann das ein Ansatzpunkt für eine Maßnahme sein:
Der Hersteller bietet dann zum Beispiel erweiterte Schulungen oder passt die Anwendungshinweise an, um die Zuordnung eines Implantates zu einer Indikation zu erleichtern.
Eine Untersuchung des wissenschaftlichen Instituts der AOK hat große Unterschiede in der Behandlungsqualität bei Kniegelenkersatz ergeben: Die besten Kliniken verzeichnen nur halb so hohe Komplikationsraten wie die Häuser im unteren Viertel der Bewertungsskala.
Der AOK-Bundesverband plädiert deshalb dafür, die Mindestzahl von jährlich 50 Operationen zu erhöhen.
Prof. Karl-Dieter Heller, ärztlicher Direktor, Chefarzt der Orthopädischen Klinik und Leiter des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung am Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig, nimmt in der ÄrzteZeitung dazu Stellung:
Das kann ich nur unterstützen. 50 Operationen – eine pro Woche, das ist definitiv zu wenig. Zumal wir ja sehr unterschiedliche Implantate verwenden, die jeweils eigene Ansprüche an den Operateur stellen: Es gibt bikondyläre Oberflächenersatzprothesen, Schlittenprothesen und Wechselendoprothesen.
Höhere Op-Zahlen bedingen meist auch bessere Ergebnisse. Die Behandlungsqualität bei Knie-TEP hängt entscheidend von der Routine des Operateurs ab. Auch bei einer Mindestmenge von 50 Prothesen können sich diese Eingriffe auf zehn Ärzte verteilen, von denen keiner entsprechende Routine erlangt.
Mein Vorschlag: Mindestmengen für jede Variante. Beispielsweise wenigstens 70 Oberflächenersatzprothesen, 30 Schlitten, 20 Wechseloperationen. Am Ende sollte eine Klinik mindestens 120 dieser Operationen aus diesen drei Bereichen durchführen.
Bei uns im Herzogin Elisabeth Hospital sind es jedes Jahr rund 2100 Endoprothesen, darunter 1000 Hüft- und 800 Kniegelenke, der Rest sind Wechseloperationen. Ich selbst führe jährlich über 600 Endoprothesen-Operationen durch.
Endoprothesenregister in Europa und Österreich
Auch europaweit gibt es mit NORE ein Netzwerk der orthopädischen Register Europas. Es konzentriert sich auf die Überwachung von Medizinprodukten und auf Ergebnisse aus der Hüft- und Knieendoprothetik, um Verbesserungen in der Patientenversorgung zu unterstützen.
Die interaktive Karte des europäischen Registers NORE enthält Primär- und Revisionsdaten aus den wichtigsten europäischen Registern, darunter auch das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD).
Im Juni 2024 wurde die Implantatklassifikation des Endoprothesenregisters Deutschland (EPRD) und des britischem National Joint Registry (NJR) auf dem 13. International Congress of Arthroplasty Registries (ISAR Congress) in Hamburg zum weltweiten Standard erhoben.
Diesem Schritt ging eine langjährige Zusammenarbeit mit dem britischen NJR voraus, um das Klassifizierungssystem zwischen den beiden Registern zu harmonisieren. Durch die einheitlichen Klassifizierungsmerkmale sollen registerübergreifende Analysen einfacher durchführbar werden.
Zur Information: Das National Joint Registry (NJR) in Großbritannien erfasst Daten zu Gelenkersatzoperationen (Hüfte, Knie, Knöchel, Ellbogen, Schulter) in England, Wales, Nordirland, Isle of Man und Guernsey. Ziel des Registers ist es mit aktuell vier Millionen Einträgen, die klinische Qualität und Sicherheit zu verbessern, indem es Daten zu Implantaten, Operationsergebnissen und der Leistung von Krankenhäusern und Chirurgen sammelt und analysiert.
In Deutschland gab es bezüglich Endoprothesenregister eine Änderung. Künftig sollen Daten aus dem Endoprothesenregister Deutschland in das gesetzlich vorgeschriebene neue Implantatregister Deutschland (IRD) überführt werden.
Seit Jänner 2025 werden implantierte Knie- und Hüft-Endoprothesen im IRD erfasst . Bis eine aussagekräftige Datenbasis geschaffen ist, dürfte es aber voraussichtlich mehrere Jahre dauern. Fraglich ist auch, ob die vorgesehene Falldokumentationen des IRD weniger klinisch relevante Informationen bereithalten wird, als im EPRD angestrebt. An Lösungsvorschlägen zur gegenseitigen Nutzung der Datenbestände wird gearbeitet.
Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) sieht das gesetzliche Implantateregister (IRD) im Bereich des Hüft- und Kniegelenkersatzes kritisch. „Wir benötigen auch weiterhin umfassende Daten zur Performance unserer Endoprothesen auf Implantat- und Klinik-Ebene, um unsere Produkte im Markt und der Patientenversorgung halten zu können“, sagte der stellvertretende BVMed-Vorstandsvorsitzende Marc Michel.
Anfang 2025 hat das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) zwei wesentliche Neuerungen eingeführt.
Erstens ist die elektronische Befragungslösung zur Erhebung von Patient Reported Outcome Measures (PROMs) nun für alle teilnehmenden Kliniken verfügbar. Sie basiert auf etablierten Scores (Oxford Hip Score OHS und dem Oxford Knee Score OKS) zur Bewertung des Gesundheitszustands vor und nach der Operation.
Zweitens wurden neue Dokumentationsfunktionen eingeführt, darunter die Erfassung des operativen Zugangs bei Hüftprothesen sowie Angaben zu OP-Techniken bei Knieprothesen. Zudem gibt es ein optionales Infektionsmodul für weiterführende Analysen.
Endoprothesenregister Österreich: zu wenig Daten, kein echtes Register
Zum Schluss noch ein Blick auf Österreich: Warum gibt es kein vergleichbares Register für österreichische Kliniken und Patient*innen? Gelenkexperte Priv.-Doz. Dr. Jochen Hofstätter, Orthopädischen Spital Speising, hat dazu in einem Tirolturtle-Interview Stellung genommen:
Das in vielen Ländern verpflichtende Endoprothesenregister gibt es in Österreich nicht.Wenn man sich überlegt, wieviel tausende Patienten operiert werden, gibt es aber viel zu wenig Daten über die Langlebigkeit der Hüft-und Knieendoprothesen. Ein zentrales Endoprothesenregister würde da sehr zur Patientensicherheit beitragen.
Seit dem Interview mit Dr. Jochen Hofstätter über die Sicherheit von Implantaten, Endoprothesenregister Österreich, Revision-OPs, etc. hat sich nicht viel getan.
Österreich hat nach wie vor kein Endoprothesenregister. 2025 wagt Wien bzw. die Vinzenz-Gruppe einen Vorstoß. Priv.-Doz. Dr. Jochen Hofstätter sagt dazu:
Wir sind auf dem besten Weg, ein einzigartiges Endoprothetikregister unserer gesamten Vinzenz Gruppe zu erstellen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Register, sondern auch um bildgebende Verfahren sowie patientenspezifische und chirurgische Daten und es werden auch fortschrittliche Analysewerkzeuge wie KI und maschinelles Lernen eingesetzt.
Für die personalisierte Orthopädie sind Daten aus der realen Welt erforderlich, und wir hoffen, dass unser Ansatz letztendlich dazu beitragen wird, die Patientenergebnisse zu verbessern und Komplikationen zu reduzieren.
Das Register soll gemeinsam mit Reinhold Ortmaier, Prim. Prof. Dr. Dr. und Elpida Bantra über das Michael Ogon Laboratory for Orthopaedic Research für das Orthopädisches Spital Speising, Herz-Jesu Krankenhaus, Ordensklinikum Linz, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und Linz, umgesetzt werden.
Österreichweit wird neben Wien auch im Bundesland Tirol und zwar über das Prothesenregister Tirol (PRT) Daten gesammelt.
Hinweis: Die hier geteilten Informationen sollen zur Stärkung der persönlichen Gesundheitskompetenz beitragen, ersetzen aber in keinem Fall die ärztliche Diagnose, Beratung und Behandlung.
Foto: EPRD


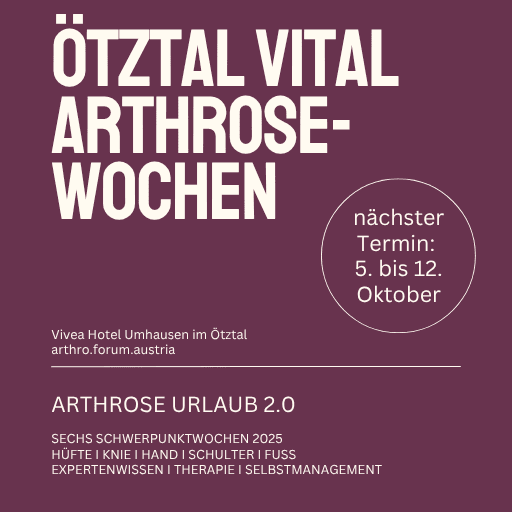



No Comments