Künstliche Intelligenz in der Arthrose-Diagnostik. Ob Röntgen, MRT oder Ultraschall – smarte Systeme analysieren Gelenkbilder automatisch. Drei europäische Projekte zeigen, wohin die Reise geht.
Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in die bildgebende Diagnostik bei Arthrose. Immer mehr Systeme (Röntgen, MRT, Ultraschall) können Gelenkbilder automatisch analysieren und objektive Informationen liefern. Doch wer entwickelt diese Technologien eigentlich? Ein Überblick über drei wegweisende Projekte aus Forschung und Praxis.
Drei Projekte zeigen, wie künstliche Intelligenz die Arthrose Diagnose verändern könnte
Die bildgebende Diagnostik spielt bei Arthrose eine zentrale Rolle – sei es zur Beurteilung von Gelenkverschleiß, zur Verlaufskontrolle oder zur Entscheidung über operative Maßnahmen. Doch: Die Auswertung von Röntgen, MRT oder Ultraschall hängt bislang stark von ärztlicher Erfahrung und subjektiver Einschätzung ab.
Das könnte sich bald ändern. Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend eingesetzt, um medizinische Bilddaten objektiv und automatisiert auszuwerten. In Europa arbeiten derzeit mehrere Initiativen und Unternehmen daran, solche Technologien zur Praxisreife zu bringen – mit sehr unterschiedlichen Ansätzen.
AutoPiX: EU-Forschungsprojekt zur KI in der Bildgebung
Das AutoPiX-Projekt, gestartet im November 2024, wird von der Innovative Health Initiative (IHI) der Europäischen Union gefördert. Ziel ist es, KI-basierte Werkzeuge zu entwickeln, die medizinische Bilddaten (MRT, Röntgen, Ultraschall) automatisch analysieren und in quantifizierbare Biomarker umwandeln – etwa Knorpeldicke, Entzündungszeichen oder strukturelle Schäden.
Zwar liegt der Fokus derzeit auf entzündlichen rheumatischen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis und Psoriasis-Arthritis. Doch die technologischen Entwicklungen sind auch für die Arthrose Forschung hochrelevant, etwa zur frühzeitigen Detektion von Gelenkveränderungen oder zur objektiven Verlaufskontrolle.
Das Projekt wird von der Medizinischen Universität Wien (Prof. Daniel Aletaha) koordiniert, beteiligt sind 17 Partner aus Forschung, Industrie und Patientenvertretung – darunter Janssen, ULiège und das Forschungszentrum CHUV Lausanne. Das Budget: über 20 Millionen Euro bis Oktober 2029.
Mehr zum Projekt: autopix-project.eu
Chondrometrics: MRT-Messdaten für die Forschung
Das deutsche Unternehmen Chondrometrics GmbH ist ein Pionier in der quantitativen Auswertung von MRT-Bildern des Gelenkknorpels. Entwickelt wurde die Technologie unter der Leitung von Prof. Dr. Felix Eckstein, einem der führenden Forscher im Bereich Knorpelstruktur und Abbau.
Chondrometrics liefert präzise Messdaten zu Knorpeldicke, Volumen, Oberflächenqualität und Defekten – einsetzbar in klinischen Studien, Wirkstoffprüfungen und Zulassungsverfahren. Auch in der Entwicklung neuer Knorpeltherapien und Biomaterialien spielen die Algorithmen von Chondrometrics eine Rolle. Für Patienten sind die Tools zwar nicht direkt zugänglich, für die Forschung aber unverzichtbar.
ImageBiopsy Lab: Röntgen-KI aus Österreich
Ein deutlich praxisnäherer Zugang kommt vom Wiener Unternehmen ImageBiopsy Lab. Das Start-up hat sich auf die automatisierte Auswertung von Röntgenbildern mittels KI spezialisiert. Die Software KOALA (Knee Osteoarthritis Labelling Assistant) erkennt arthrosespezifische Veränderungen im Knie, basierend auf Standard-Röntgenbildern, die in der klinischen Routine ohnehin gemacht werden.
Ziel ist eine objektive, reproduzierbare Befundung, die Ärzten im Alltag unterstützt und auch Verlaufskontrollen ermöglicht. Das Unternehmen arbeitet mit orthopädischen Kliniken und radiologischen Einrichtungen im DACH-Raum zusammen und will seine Lösungen künftig auch auf Hüfte, Hand und Wirbelsäule ausweiten.
Mehr dazu im Magazin: KOALA und KI
KI auch in der Endoprothetik angekommen
Nicht nur bei der Auswertung von Gelenkbildern, auch bei der Planung und Durchführung von Gelenkersatzoperationen kommt KI zunehmend zum Einsatz. Auf dem DKOU Kongress – dem größten Orthopädie-Kongress Europas – wurden neue KI-Anwendungen vorgestellt, die Implantate präziser platzieren und OP-Abläufe optimieren sollen.
So helfen KI-Systeme dabei, individuelle Risiken besser einzuschätzen, patientenspezifische 3D-Modelle zu erstellen und die Positionierung von Knie- oder Hüftprothesen zu verbessern. Ziel ist eine noch präzisere und personalisierte Endoprothetik gerade bei komplexen Fällen.
Was macht Künstliche Intelligenz bei Arthrosebildern eigentlich?
Künstliche Intelligenz (KI) wird in der Bildgebung nicht „kreativ“, sondern erkennt wiederkehrende Muster, strukturelle Veränderungen oder Maßeinheiten, die manuell oft schwer zu erfassen sind. Bei Arthrosebildern bedeutet das:
- Messung von Knorpeldicke oder -volumen (z. B. in MRTs)
- Erkennung typischer Arthrosezeichen wie Gelenkspaltverschmälerung, Osteophyten oder Sklerosen (z. B. in Röntgenbildern)
- Vergleich von Verlaufsdaten über Monate oder Jahre
- Unterstützung bei der Entscheidung, ob ein Gelenkersatz sinnvoll sein könnte
KI hilft also dabei, aus Bilddaten objektive, reproduzierbare Informationen zu gewinnen – eine wichtige Ergänzung zur klinischen Erfahrung der Ärzte.
Ausblick: Was kommt als Nächstes in der KI-Diagnostik?
Die Entwicklung geht rasant weiter – hier einige Trends und Projekte, die in Zukunft wichtig werden könnten:
- Kombination mit klinischen Daten: KI-Modelle, die neben Bildern auch Laborwerte, Fragebögen oder Bewegungssensoren einbeziehen
- KI für andere Gelenke: Neue Tools sind in Arbeit für Hüfte, Handgelenk, Schulter und sogar Wirbelsäule
- Schnellere Studien-Auswertung: Pharmafirmen und Forschungseinrichtungen setzen KI vermehrt zur standardisierten Bewertung großer Bilddatenmengen ein
- Echtzeit-KI in der Praxis: Systeme, die während der Untersuchung (z. B. im Ultraschall) direkt Rückmeldung geben
- Integration in digitale Befundsysteme: KI-Befunde als Teil von Radiologieberichten – inklusive Vorschlägen zur Klassifikation (z. B. Kellgren-Lawrence-Grad)
Ob als Forschungsplattform, Studienwerkzeug oder praxisnahe Diagnosehilfe – Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsseltechnologie in der Arthrose-Diagnostik. Während AutoPiX noch Grundlagen schafft, liefern Chondrometrics und ImageBiopsy Lab bereits heute anwendbare Lösungen. Und der nächste Schritt – etwa in der Endoprothetik – ist längst in Vorbereitung.
Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Erlangen konnte mithilfe künstlicher Intelligenz rheumatoide Arthritis, Psoriasisarthritis und gesunde Gelenke anhand von Fingergrundgelenken zuverlässig unterscheiden – mit Trefferquoten bis zu 82 %. Die Technologie basiert auf hochauflösenden HR-pQCT-Bildern und eröffnet neue Wege für eine gezieltere Diagnose und Therapie entzündlicher Gelenkerkrankungen. Auch auf Arthrose könnte der Ansatz künftig übertragbar sein. (Quelle: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Jatros 3/2022)
Auch in Österreich arbeitet ein Forschungsteam mit KI daran, Gelenkerkrankungen besser zu verstehen – von Entzündung bis Arthrose. Ein Team um Prof. Dr. Michael Bonelli, Rheumatologe an der Medizinischen Universität Wien, untersucht gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Arthritis und Rehabilitation sowie dem CeMM-Forschungszentrum, wie chronische Entzündungen in Gelenken entstehen.
Zu den führenden Köpfen des Instituts zählen auch Prof. Dr. Tanja Stamm, Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts, und Dr. Bibiane Steinecker, stellvertretende Institutsleiterin und Expertin für Rehabilitation und Arthroseforschung. Gemeinsam arbeiten sie daran, das Zusammenspiel von Immunzellen und Gelenkgewebe besser zu verstehen und Medikamente gezielt an Zellkulturen zu testen – bevor diese bei Patienten eingesetzt werden.
Langfristig soll dieser Ansatz auch auf die Früherkennung und personalisierte Behandlung von Arthrose ausgeweitet werden. Ein weiteres wichtiges Werkzeug dafür ist das österreichweite Arthroseregister, das bereits die Krankheitsverläufe von über 1.500 Arthrosepatienten dokumentiert.
Hinweis: Die hier geteilten Informationen ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Sie sollen helfen, deine Gesundheitskompetenz zu stärken und dich bei der Suche nach fundierten Informationen unterstützen.
Redaktioneller Beitrag von Barbara Egger-Spiess, Gesundheitsjournalistin & Herausgeberin des Arthrose Magazins



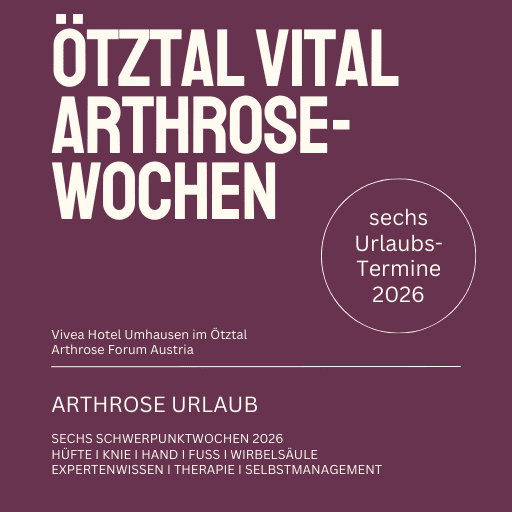



No Comments